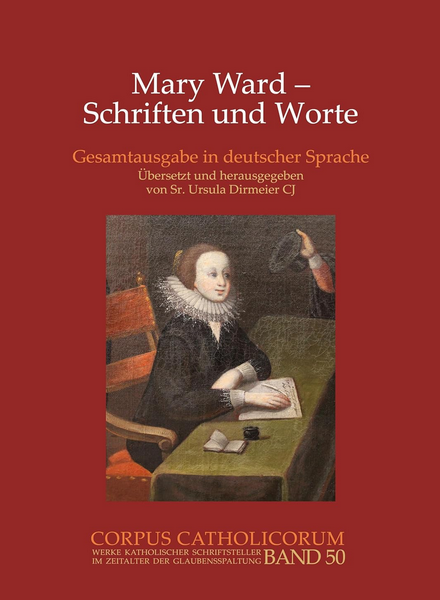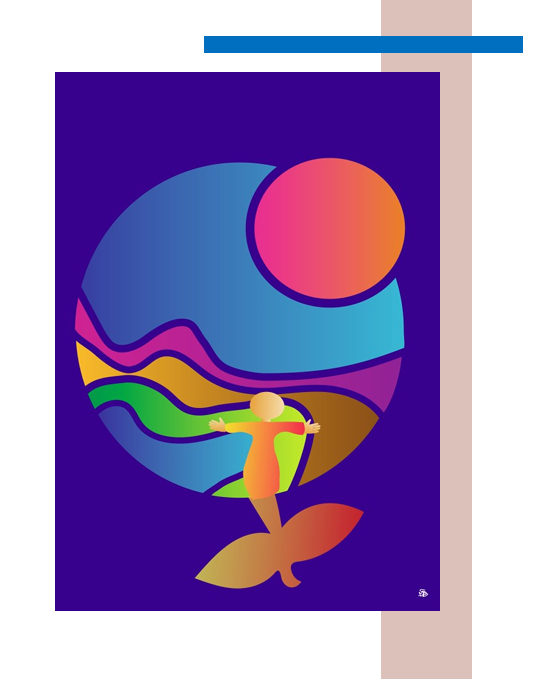Die Aktualität Mary Wards

Die Aktualität Mary Wards in den gegenwärtigen turbulenten kirchlichen und politischen Zeiten soll beschrieben werden. Also beginne ich mit einem über vierhundert Jahre alten Wort einer Frau: „Bisher wurde uns von Männern gesagt, wir müssten glauben. Es ist wahr, wir müssen es. Aber lasst uns weise sein und wissen, was wir zu glauben haben und was nicht“.[1]
Mary Ward sagte das ihren Mitschwestern in Saint-Omer im Jahr 1617, als diese durch die abfällige Rede eines Jesuiten verunsichert worden waren, der meinte, ihr inneres Feuer werde wohl rasch erkalten; denn „schließlich sind sie nur Frauen.“ Es wäre eine Untersuchung wert, in welchen Zusammenhängen, politischen und wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen und natürlich auch religiösen, Frauen weltweit ähnlich abgewertet werden und sich in diesem Wort Mary Wards wiederfinden können. Ohne der Untersuchung vorzugreifen, behaupte ich: Es sind viele. Aber Mary war mit ihrem Satz noch nicht zu Ende: „(Lasst …) uns nicht glauben machen, dass wir nichts tun können.“
„….schließlich sind sie nur Frauen“
Was sie mit ihren Mitschwestern zu tun vorhatte, war die Weitergabe des Glaubens auf der Basis eines Bildungsangebots für Mädchen und Frauen. Ausgangspunkt ihres Einsatzes war die Situation der Katholikenverfolgung in England, in der eine Seelsorge ohne die Mitwirkung von Frauen nicht möglich war. Deshalb konnten und wollten sie sich nicht hinter die Klostermauern zurückziehen. Gott setzt auf die Mitwirkung seiner Geschöpfe ohne Ansehen des Geschlechts.
Mary Ward ließ sich weder vom Dreißigjährigen Krieg noch von uneinsichtigen mächtigen Männern hindern, sondern lebte ihre Überzeugung: „Darin bestehen echte Stärke und Mut, wenn man das, was man als gut erkennt, wie immer die Umstände auch sein mögen, in die Tat umsetzt und sich von keinem Hindernis davon abhalten lässt.“ Diesen Spruch kann ich auf der Fassade des Gymnasiums gegenüber meinem Fenster lesen und hoffe dabei, dass er nicht falsch verstanden wird. Denn wieviel Leid und wieviel Unheil entstehen gerade dadurch, dass Menschen unter allen Umständen in die Tat umsetzen wollen, was sie für gut und richtig halten, auch wenn es den davon Betroffenen, weil darunter Leidenden, noch so schräg und falsch und bedrohlich vorkommt. Was man als gut erkannt hat, muss schon erst die Prüfung bestehen, ob es auch von möglichst vielen Anderen als etwas Gutes wahrgenommen werden kann und ob es auch für die Zukunft etwas Gutes erhoffen lässt.
Tun, was als gut erkannt wird.
Worauf Mary Ward Rekurs für das Gute nahm, ist eindeutig: „Veritas Domini manet in aeternum; die Wahrheit unseres Herrn währt immerdar. Es ist nicht die veritas hominum, die Wahrheit der Männer oder die Wahrheit der Frauen, sondern veritas Domini.“ An dieser Wahrheit nimmt sie Maß dafür, was sie zu glauben hat und was nicht. Zusammen mit ihrem geistlichen Lehrmeister Scupoli ist sie überzeugt, dass man durch eine tiefgehende, gründliche Erwägung der Dinge erfassen kann, wie sie tatsächlich sind und nicht bloß zu sein scheinen; dass also die Wahrheit dessen erkannt werden kann, was wirklich gut ist und die Falschheit und Nichtigkeit des anderen, das nie leistet, was es nach außen hin verspricht und nur den Frieden des Herzens raubt.
Voraussetzung ist, dass man nichts anziehend findet und sein Herz daran hängt, was nicht zuvor im Licht des Verstehens erkannt und gründlich geprüft und erwogen wurde, dabei unterstützt vom Licht der Gnade und des Gebets.[2] Das Wissen um eine das Menschliche übersteigende höhere Instanz ist also das eine. Das andere ist die Überzeugung, dass es den ebenso undefinier-, wie unverzichtbaren gesunden Menschenverstand braucht, der angesichts einer Flut unüberschaubarer (Falsch-)Nachrichten schlicht nachfragt: „Kann das denn sein?“ oder: „Wie wahrscheinlich ist das?“ oder eben: „Kann daraus etwas Gutes entstehen?“
Freilich, so Mary Ward, gibt es neben der einen großen Wahrheit Gottes die eigene kleine, wenn sie sagt: „Ich kann nicht anders als diese Wahrheit, diese Wirklichkeit, von der ich überzeugt bin, zu verteidigen, dass das innere Feuer nicht zwangsläufig erkalten muss, weil wir Frauen sind. Ich habe jedoch nicht die Absicht, diesen Pater zu tadeln. Von diesem Punkt abgesehen, mag er viel Erkenntnis besitzen und vielleicht besitzt er alle andere Erkenntnis und ich besitze nur diese Erkenntnis und Klarheit über diese einzige Wahrheit, durch die ich vielleicht gerettet werden muss. Deshalb muss und werde ich immer für diese Wahrheit einstehen, dass Frauen vollkommen sein können und dass das Feuer nicht zwangsläufig erkaltet, weil wir Frauen sind.“ Wenn also doch jeder so seine eigene(n) Wahrheit(en) besitzt, müsste der Weg zum Handeln im wechselseitigen Austausch bestehen, in der gewaltfreien Kommunikation, im demokratischen Diskurs, in der synodalen Gesprächskultur.
Schwer nachvollziehbare Gehorsamsbereitschaft
Aber soweit war das Papsttum des 17. Jahrhunderts nicht. Ihm gegenüber zeigte Mary Ward eine heute nur schwer nachvollziehbare Gehorsamsbereitschaft. „Gemäß der Anordnung der Eminenzen Kardinäle des Heiligen Offiziums bin ich nach Rom gekommen und biete nun zu Füßen Eurer Heiligkeit demütig und unverzüglich meine arme Person und mein kurzes Leben zur vollständigen Erfüllung dessen an, was Eurer Heiligkeit mehr gefällt.“ Mit diesen Worten meldete sie sich Anfang 1632 in Rom bei Papst Urban VIII., nach zweimonatiger Inquisitionshaft in München und einem quälenden Hin und Her sich widersprechender Dekrete nun der Fortsetzung des Inquisitionsprozesses gegen sie gewärtig. Sie hatte es schon einige Jahre zuvor angekündigt. Sie könne von dem, was sie als ihre Wahrheit erkannt hatte, „ablassen, wenn Seine Heiligkeit und Ihre Eminenzen es für gut hielten, aber etwas ändern oder etwas anderes annehmen könne sie nicht.“ Das Angebot, sich dem Zugriff der Inquisition durch Flucht aus dem Kirchenstaat zu entziehen, schlug sie aus; bedenkenswert für alle, die vor der Frage nach Flüchten oder Standhalten stehen.
Zugleich wehrte sie sich mit erstaunlicher Zähigkeit dagegen, dass gegen sie geurteilt würde, ohne die Fakten unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen. So diktierte sie am 27. März 1631 in der Haft, in Todesgefahr und bereit, ohne die Sakramente zu sterben, statt eine missverständliche Erklärung zu unterschreiben, das Folgende: „Falls sich jedoch in dem, was zunächst von den Päpsten und heiligen Kongregationen der Kardinäle gebilligt und autorisiert wurde und in dem ich gemäß meiner geringen Kraft der heiligen Kirche zu dienen wünschte und suchte, (durch die, denen die Entscheidung über solche Angelegenheiten zukommt) entschieden werde (nachdem die Wahrheit in allem wahrgenommen wurde), es sei darin etwas, was der Pflicht einer wahren Christin oder dem geschuldeten Gehorsam gegenüber Seiner Heiligkeit oder der Kirche widerstreitet, bin ich und werde ich (mit der Gnade Gottes) immer die Bereitwilligste sein, meine Schuld anzuerkennen, um Verzeihung für die Verfehlungen zu bitten und zusammen mit der bereits geschehenen öffentlichen Entehrung und den mir auferlegten Leiden mein armseliges und kurzes Leben anbieten, um für besagte Sünde zu sühnen.“
Wahrhaftigkeit eingefordert
Sie gehorchte dem Papst, weil er der Papst war. Zugleich blieb sie dem verpflichtet, wozu Gott sie berufen hatte. Bemerkenswert auch, dass sie sich für den Priester einsetzte, der sie inhaftiert hatte und ihr die kirchlichen Beschlüsse mitteilen musste. Er war nämlich gerügt worden, weil er Mary Ward auf ihre Bitte hin ein Originalschreiben des Heiligen Offiziums gezeigt hatte. Sie schrieb daraufhin unumwunden an besagte Instanz: „Ich hoffe, dass er das gründlich missverstanden hat. Denn es hat nicht den Anschein, möglich sein zu können.“ Sie forderte Transparenz ein und erwartete Wahrhaftigkeit, wie sie sie zu geben bereit war.
Vom Vorwurf der Häresie freigesprochen, fuhren sie und die wenigen, die geblieben waren, mit erstaunlicher Beharrlichkeit fort, durch Mädchenbildung der Kirche zu dienen, in einer Gruppierung „weltlicher“ Frauen, die nicht aufhören mochten, ihre Berufung zu leben. „Fürchte nur, zu viel zu fürchten“ hatte sie schon früher einer Mitschwester geschrieben, die zum lebensgefährlichen Einsatz nach England aufbrach. Am Gedenktag des Apostels Petrus in Ketten hatte sie einmal im Gebet für ihr Institut erkannt, „dass dessen Wohlergehen, Entwicklung und Sicherheit nicht in Reichtum, Einfluss und Fürstengunst bestehe, sondern darin, dass seine Mitglieder einen freien Zugang und offenen Zutritt zu Gott haben, von dem alles an Kraft, Erkenntnis und Schutz herkommen muss.“
„Fürchte nur, zu viel zu fürchten“
Das Vertrauen auf Gott und die Zuversicht, dass sich verwirklichen werde, was von Gott gewollt ist, waren das Fundament, auf das sie in allem gründete und auf dem sie nach dem Erdbeben der päpstlichen Unterdrückungsbulle wieder aufbaute. Sie war überzeugt: „Alles, was nicht in Gott und für Gott ist, wird mit der Zeit vergehen.“ Die zurückliegenden vierhundert Jahre haben ihr rechtgegeben und das Lied vieler Frauen ist auch ihr Lied: Von Herzen juble ich über Gott, meinen Retter. Er hat auf mich unbedeutende Frau geschaut. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Geringen. Gott hat sich meiner erbarmt.
Text: Sr. Ursula Dirmeier, Bild: Erwin Reiter
[1] Die Zitate sind entnommen aus: Mary Ward – Schriften und Worte. Gesamtausgabe in deutscher Sprache. Übersetzt und herausgegeben von Ursula Dirmeier, Münster 2024. In der jeweiligen Originalsprache finden sie sich in: Mary Ward und ihre Gründung. Die Quellentexte bis 1645. Herausgegeben von Ursula Dirmeier, 4 Bände, Münster 2007.
[2] Vgl. Lorenzo Scupoli, The Spiritual Conflict. Nachdruck: English recusant literature 8.2 (Edit. D. M. Rogers), Menston 1972, Chapter 4: Of the exercise of understanding.
Dieser Text ist zuerst im theologischen Feuilleton feinschwarz.net erschienen.